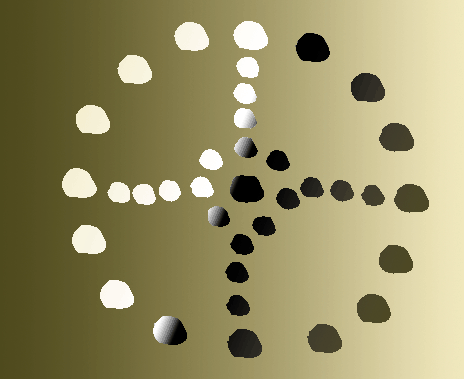

Seite optimiert für 1280 x 1024 << kleiner | größer >> | impressum | home |
Inhalt



anklicken zum Vergrößern der Umschlagtexte

zum Vorwort von Günter Wallraff
zum Interview mit Christel Bienstein
zum Interview mit Klaus Dörner
Vorschläge und Anregungen für ein menschliches, würdevolles Leben im Alter

Vorwort
von Günter Wallraff
Als mich Markus Breitscheidel vor nunmehr sechs Jahren aufsuchte und nach längeren Gesprächen damit herausrückte, dass ihn seine bisherige recht erfolgreiche Angestelltenexistenz nicht nur nicht ausfüllte, vielmehr immer mehr verzweifeln lies, spürte ich, dass hier jemand eine radikale Wende in seinem Leben beabsichtigte. Andere lassen in so einer Situation alles hinter sich, fahren mit dem Fahrrad einmal um die Welt, wandern in ein möglichst fernes exotisches Neuland aus oder suchen ihr Heil in einem japanischen Zen-Kloster, meist vergeblich.
Markus Breitscheidels Flucht aus einer gesicherten und gesellschaftlich angesehenen Berufsperspektive und sein Abstieg und Abtauchen in die Tabuzonen deutscher Pflege- und Altenheime geht weit über die übliche journalistisch investigative Recherche heraus.
Aus seiner Expedition in eine soziale Hölle entstand ein zutiefst aufrüttelnder Insider- und Tatsachenbericht. Empfehlenswert für alle, die nicht verdrängen wollen, dass sie auch einmal alt und pflegebedürftig werden könnten. Und Pflichtlektüre für die Ausnahmepolitiker, die sich noch ein Gewissen leisten und soziale Verantwortung spüren.
Seine Annäherung an die ihm anvertrauten Pflegebedürftigen ist trotz permanenter Überforderung immer hilfsbereit und liebevoll und folgerichtig hat seine fast zweijährige Inspektion so gar nichts von einem sensationsheischenden und voyeuristischen Skandalbericht.
Die Auswahl seiner Heimsuchungen geschah rein zufällig, sodass man davon ausgehen kann, dass die geschilderten Zustände einen repräsentativen Querschnitt und keineswegs besonders krasse Ausnahmefälle darstellen. Und selbst seine positive Erfahrung im Pro-Seniore-Heim, Berlin scheint eher der Initiative eines human eingestellten Heimleiters zu verdanken sein, als dem Gesamtkonzept dieses Wirtschaftsunternehmens, wie mir zugänglich gemachte Klagen von Pro-Seniore-Heimbewohnern aus anderen Teilen Deutschlands nahe legen.
Viele seiner Schilderungen versetzen mich in die Anfänge meiner Arbeit zurück, als ich in Industriebetrieben seelenloser und entfremdeter Akkordhetze und Fliessbandarbeit ausgesetzt war. Mit dem kleinen Unterschied, dass hier die im Akkordtakt zu verrichtenden Handgriffe Menschen und nicht einer Warenproduktion gelten. Da werden wehr- und hilflose alte Menschen abgearbeitet, Akkord-Checklisten abgehakt und wer Sperenzchen macht, zu viele Fragen stellt oder sich gar zu beschweren wagt, der wird abgeschossen, d.h. mit Beruhigungsmitteln gewaltsam vollgepumpt.
"Keine Zeit" ist der Standardsatz im Repertoire der meist schlecht ausgebildeten und unterbezahlten Pflegenden. Der Heimbewohner reduziert auf eine Existenz als bloßer Kostenfaktor. Für die simpelsten Hilfeleistungen fehlt die Zeit und das Personal. Jemanden, der gebrechlich ist, zur Toilette zu begleiten, ist zu zeitaufwendig. Da werden – oft gewaltsam – Windeln angelegt oder Dauerkatheder gesetzt, obwohl der Pflegefall gar nicht inkontinent ist. Das schuldet man dem Prinzip Rationalisierung und Gewinnmaximierung.
Jeder Handgriff bis ins Detail festgelegt und durchkalkuliert, die Pflege am lebenden Menschen voll industrialisiert; Ansprache, Zuwendung gar im Kostenplan nicht vorgesehen. Obwohl Geld genug da ist über die Mittel der Pflegeversicherung und die immer höhere Belastung der Angehörigen. Vor 10 Jahren noch kostete ein Heimplatz ca. 3000 DM, heute beansprucht das Heim bis zu 4000 Euro für deutlich weniger Leistung.
Der Autor beschreibt, dass er nie erlebt hat, dass ein Heimbewohner aus einer höheren Pflegestufe in eine niedrigere zurückgestuft wurde. Eine Verbesserung der Gesundheit des Bewohners ist ökonomisch betrachtet ein wirtschaftlicher Verlust für die Heimbetreiber. Deren Interesse besteht im Gegenteil darin, den ihnen anvertrauten – besser ausgelieferten – möglichst schnell von der Pflegestufe I (zwischen 1500 - 1950 Euro) über die Pflegestufe II (zwischen 1950 – 2550 Euro) In die dritte Pflegestufe (zwischen 2400 – 3300 Euro) zu befördern.
Mindestens ein Drittel der Heimeinsassen, so die Schätzungen von Experten sind im Heim Fehl am Platz und wären ambulant besser und menschenwürdiger zu versorgen. "Das Angebot hat sich seine Nachfrage geschaffen", stellt Klaus Großjohann vom "Kuratorium Deutsche Altenhilfe" aufgrund seiner Erfahrungen fest. Breitscheidels Untersuchungsbericht am Beispiel von fünf Heimen ist auf die Gesamtsituation deutscher Altenheime durchaus übertragbar, geht aus einer repräsentativen Auswertung des "Arbeitskreise gegen Menschenrechtsverletzungen" hervor. Demnach sind "unter den Heimbewohnern 85% unterernährt; 36% leiden an einem Mangel an Flüssigkeitszufuhr; 25% haben beginnende Dekubitusgeschwüre. Magensonden werden gelegt um die Hilfestellung beim Essen einzusparen, Dauerblasenkatheder, um das Blasentraining und die Begleitung zur Toilette einzusparen. 400.000 freiheitsentziehende Maßnahmen wie Festbinden, doppelte Bettgitter, Verabreichen von Psychopharmaka (oft ohne richterliche Genehmigung) finden jährlich in den Heimen statt. Die an den Alten begangenen Straftatbestände wie Nötigung, Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Misshandlung Schutzbefohlener usw. werden so gut wie nie geahndet. Etwa 10.000 Menschen sterben bundesweit (so hochgerechnete Obduktionsbefunde) jährlich an mangelnder Versorgung und Pflege."

Mich interessiert: "Wo bleibt das Geld?"
Interview mit Christel Bienstein zur Situation der Pflege in DeutschlandChristel Bienstein ist seit 1994 Leiterin des Instituts für Pflegewissenschaft an der Privaten Universität Witten/Herdecke. Zuvor kämpfte sie über zehn Jahre für die Einführung der Pflegewissenschaft und Forschung in Deutschlang. Sie unterrichtet an verschiedenen Universitäten (u. a. Berlin, Bremen, Osnabrück) und Fachhochschulen und ist Mitglied in zahlreichen Ausschüssen und Beiräten. Biensteins Arbeitsschwerpunkt ist die Entwicklung von differenzierten, praxisorientierten Weiter- und Fortbildungsbausteinen für die Pflegenden sowie die Organisation von Wohngruppen statt Heimen für Pflegebedürftige.
Viele Pflegende kritisieren die engen Zeitkorridore der Pflegeversicherung, weil sie in den vorgegebenen Zeiten ihre Arbeiten nicht schaffen. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
Erstaunlich ist, dass diese zeitlichen Korridore relativ gut greifen. Das Problem liegt woanders, nämlich in dem Umstand, dass man eine Person nie nur ausschließlich wäscht, sondern gleichzeitig mehr mit ihr macht: Man integriert spontan präventive und Prophylaxemaßnahmen, man mobilisiert die zu Pflegenden, setzt sie auf, spricht mit ihnen über Gott und die Welt, man übt Aufstehen und Hinsetzen, macht also gleichzeitig mehrere Dinge, die in der Zeitspanne "Waschen" nicht aufgelistet sind. Dieses integrative Arbeiten ist aber etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches. Sie sitzen ja auch nicht nur am Frühstückstisch und kauen wortlos Ihr Brötchen, sondern unterhalten sich, gucken vielleicht Fernsehen oder in die Zeitung, stehen zwischendurch auf, stellen die Spülmaschine an und schmieren das Pausenbrot für die Kinder. Genau das spiegelt sich in der Pflege auch wieder: Die einzelnen Tätigkeiten fließen immer ineinander über und sind nie klar voneinander abzugrenzen.
Aber gerade dieser Umstand verschärft doch das Problem, dass den Pflegenden – wenn sie sich so wie beschrieben einsetzen – viele Minuten nicht bezahlt werden.
Das ist der Stolperstein, besonders für die häuslichen Pflegedienste, die nur Leistungen abrechnen können, die sich im Rahmen dieser Pflegeversicherung widerspiegeln, in eben diesen engen Korridoren, die nur Waschen, Hilfe beim Anziehen, bei der Nahrungsaufnahme und bei der Mobilität berücksichtigen und nichts darüber hinaus.
Es gibt Vorschläge, Geld für Pflege zukünftig anders als bisher zur Verfügung zu stellen. So könnte man zum Beispiel mit einem persönlichen Pflegebudget Betreuungsdienste bezahlen. Wie weit sind die Diskussionen um diese neue Art von Versicherung?
Bisher wird die Vergabe eines persönlichen Pflegebudgets erst in einem Modellprojekt der Pflegekassen in sieben Regionen Deutschlands getestet. Das Budget soll einen Pflegemix aus beruflicher Hilfe, familiärer Unterstützung und bezahltem, bürgerschaftlichem Engagement fördern. Besonders für Demenzkranke und alte Menschen wird es von großer Bedeutung sein, da sie lange Zeit zu Hause gepflegt werden können, nicht in ein Heim ziehen müssen und so mehr Prävention und Prophylaxe in ihren Alltag integriert wird. Um das Geld aus dem Pflegebudget auch den Bedürfnissen gerecht einzusetzen, können sich die Einzelnen bei der Ermittlung ihres ganz speziellen Bedarfs durch einen Berater, den so genannten Case Manager, helfen lassen. Die Case Manager achten auf die Qualität der Leistungen und die Qualität der Pflegebetreuung. Diese Betreuer müssen aber nicht wie bisher einen Versorgungsvertrag mit der Pflegekasse haben. Das heißt, die Kunden können Dienste ihrer Wahl engagieren. Das Modellprojekt wird bis 2008 laufen und mit seinen Ergebnissen eine Vorlage für eine mögliche bundesweite Einführung sein.
Wie sähe eine Betreuung nach diesem individuellen Pflegebudget praktisch aus?
Nun, meine Mutter ist momentan auch in dieses Modellprojekt integriert. Sie lebt in einer Dementen-WG und wird von einer Pflegerin betreut, die insgesamt dreieinhalb Stunden Zeit täglich für sie hat. In diesen Stunden geht es hauptsächlich darum, meine Mutter zu unterhalten, mit ihr zu lachen, am Tisch zu sitzen, viel zu trinken und sie beim Essen zu unterstützen. Dies ist bisher in der alten Form nicht abzurechnen gewesen, denn von den dreieinhalb Stunden wird nur rund eine für Waschen, Anziehen und Essen verwendet und der Rest der Zeit für Aktivitäten wie spazieren gehen, zusammen einkaufen oder Spiele. Bisher wird über die Pflegeversicherung nur die eine Stunde für Waschen et cetera bezahlt. Mit dem Pflegebudget lässt sich demnach auf ganz neue Weise die Versorgung alter Menschen finanzieren, wir wissen aber noch nicht, ob die Budget-Lösung die bessere ist.
Im Jahr 2000 wurden vom Gesetzgeber neue Qualitätsstandards für die Pflege in Heimen eingeführt. Haben diese neuen Standards etwas bewirkt?
Sie haben ganz viel bewirkt, denn zum ersten Mal legte die Berufsgruppe selbst das Niveau ihrer pflegerischen Leistungen verbindlich fest, und das auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse. Inzwischen werden die Pflegestandards in allen Schulen und Weiterbildungsstätten unterrichtet, und alle Pflegedirektoren kennen sie. Die Pflegeheime selbst sind unterschiedlich weit damit, die Bestimmungen anzuwenden, aber alle beziehen sich auf diese Standards. Jetzt kommen sogar Unternehmen zu mir und beschweren sich darüber, dass der Standard für Dekubitusprophylaxe erklärt, dass Hauptpflegemittel keinen nachweisbaren Einfluss nehmen auf die Verhinderung von Dekubitus. Die Pflegenden beziehen sich auf den Standard und kaufen nun keine Hautcreme mehr speziell für ihre Dekubitus-Patienten. Jetzt stellt das besagte Unternehmen aber Hautpflegemittel her und bittet uns, die gemachten Aussagen noch mal zu überprüfen beziehungsweise ihre eigenen Studien zu konsultieren – was mir signalisiert, dass mit den Standards gearbeitet wird.
Selbst die Sozialrichter kennen die Standards und legen sie ihren Befragungen zugrunde. Sie sind demnach klare und eindeutige Entscheidungshilfen – und stärken uns und den Patienten den Rücken.
Was helfen alle Standards, wenn es Heime gibt, die sich keinen Deut darum kümmern und ihre Bewohner eher vernachlässigen als pflegen?
Also ich schaue ja gern auch mal zurück. Ich bin seit mehr als dreißig Jahren in der Pflege und brauche nur einmal die Situationen von 1975 und 1995 zu vergleichen. Mir kann keiner erzählen, dass alles schlechter geworden ist. Ich hatte damals im Akutkrankenhaus noch 90 Patienten in der Nachtwache alleine zu betreuen, zusätzlich zu den Einsätzen in der Notaufnahme. Während meines Studiums war ich dann allein auf einer Intensivstation mit acht Patienten und zugleich die einzige Schwester in der Notaufnahme.
Neue Konzepte brauchen doch auch Zeit, um zu greifen: Es wird etwas entwickelt, das findet langsam den Einfluss in die Lehrbücher, dann wird es zum Gegenstand der Ausbildung. So wird es in die Praxis einfließen. Wir haben doch auch schon vieles entwickelt und setzen es um: Da sind das Case Management, die Brückenschwestern, die Entlassungsplanung in Kliniken, Verlegungsberichte für die Altenheime. Es gibt Kollegen in Altenheimen, die ins Krankenhaus gehen und sich den zukünftigen Bewohner angucken und Gespräche mit den Angehörigen führen. Altenheime praktizieren inzwischen die Bezugspflege, die Küchen werden zu Wohnküchen umgebaut, und manche Altenheime haben Wohngruppen eingerichtet, die von einem bestimmten Team betreut werden. All das hat es vor 20 Jahren nicht gegeben. Also gibt es doch eine positive Entwicklung.
Sie haben mal gesagt, dass die Pfleger in Heimen durch die kontinuierliche Begleitung der Bewohner auch ihre unterschiedlichen Individualitäten kennen lernen. Das widerspricht der These von Professor Dörner, die besagt, dass in der Institution Heim nie der Einzelne, sondern nur die gesamte Gruppe der Bewohner wahrgenommen werden kann. Wie sehen Sie das?
In vielen Heimen ist das auch so. Ich würde gern einen Tag für die Bundesbürger einführen und sagen, jeder wird jetzt verpflichtet, in das Altenheim um die Ecke zu gehen und zu gucken, wie viele Schwestern eigentlich auf der Station sind. Wir haben Situationen, wo zwei, drei Kollegen 27 Leute versorgen sollen. Die stoßen nicht mehr auf die Individualität, da müssten diejenigen schon groß "Hier" schreien und kundtun, dass sie gern Fahrräder reparieren oder spazieren gehen möchten. Und so ist es sicherlich in ganz vielen Heimen noch. Es gibt aber auch Einrichtungen, die sehr ernsthaft darüber nachdenken, wie sie dennoch einen stärkeren Blick für den Einzelnen, für die Persönlichkeiten bekommen können. Um dies zu fördern, bekommt jede/jeder Pflegende die Verantwortung für eine bestimmte Personengruppe. Denn man kann immer nur als Individuum wahrgenommen werden, wenn man eine Kontinuität sicherstellt.
Ich sehe es nicht ganz so dogmatisch wie Klaus Dörner. Sicher herrscht oft noch die Nullachtfünfzehn-Versorgung vor, und das ist noch die größere Gruppe. Die kleinere Gruppe von Heimen ist die, die den Menschen als Individuum wahrnimmt. Aber diese Gruppe wächst.
Was müsste sich ändern, damit diesem Berufsstand zu mehr gesellschaftlichem Ansehen verholfen wird?
Die fehlende soziale Anerkennung hat mit der Tabuisierung der Pflege zu tun. Pflege ist ein Ekel-Beruf und eine Ekel-Wissenschaft. Wir haben ja selbst in der Universität um Anerkennung ringen müssen, weil die Mediziner beim Stichwort Pflege immer an die letzte Lebensphase denken, an eine Zeit, wenn nichts anderes mehr geht und alles nur noch furchtbar ist. David Aldrich, unser Lehrstuhlinhaber für qualitative Forschung, hat mal gesagt: Ihr Pflegewissenschaftler braucht euch nicht zu wundern, ihr seid wie ein auslaufender Eimer. Ihr sprecht über Eiter, Erbrechen, Übelkeit, Inkontinenz, Blutverluste. Was soll daran schön sein, wer soll sich dafür interessieren? Niemand will diese Zustände, weder in seinem Leben noch in seinen Gedanken.
Die Gesellschaft identifiziert Pflege mit Siechtum. Und Siechtum war schon früher etwas, was man möglichst nicht sehen wollte, darum wurden die Siechenhäuser geschaffen, wo es unangenehm roch und niemand freiwillig hinging. Warum sollte das heute anders sein? Dieses Bewusstsein hat sich also gehalten.
Das zweite Moment hat mit ganz konkreten Erfahrungen der Bevölkerung in Krankenhäusern und Altenheimen zu tun. Dort erleben sie das Pflegepersonal nur gehetzt, freche Antworten gebend, sich nicht zuständig fühlend, nur unter Druck und abweisend. Wenn man als Außenstehende die Profession nicht spüren kann, dann ist verständlich, dass dieser Beruf keine Anerkennung erfährt.
Wenn ich also nicht erlebe, dass Pflegerinnen und Pfleger eine Berufsgruppe sind, die mich begleitet und die mich ernsthaft berät, dann braucht sich keiner über mangelndes Ansehen zu beklagen. Ich finde, dann ist das schlechte Ansehen auch berechtigt.
Was tun gegen das Dilemma?
Man kann es nur ändern, indem in den Köpfen der Kollegen sich was ändert. Die Berufsgruppe selbst ist gefordert. Meine Kolleginnen und ich arbeiten schon seit Jahren an Fort- und Weiterbildungskonzepten, wie zurzeit in der Zukunftswerkstatt der Bosch-Stiftung mit dem Titel Pflege neu denken! Dort haben wir folgendes Aufbau(Modell) vorgeschlagen:
- eine Basisqualifikation von zwei Jahren, die mindestens 50 Prozent der Pflegenden absolvieren sollten;
- eine hochwertige Ausbildung von insgesamt vier Jahren – wie in den Niederlanden und Großbritannien, und
- ein Aufbaustudium für Leiterinnen und Leiter in Pflege-Einrichtungen, die Führungs- und Managementaufgaben übernehmen können.
Die Arbeitssituation der Pflegenden muss verbessert werden. Welches sind Ihre Forderungen?
Ich wünsche mir, dass wir ein besser angepasstes Profil anbieten könnten für den jeweiligen Pflegebedarf. Dass wir eine differenzierte Struktur entwickeln und Unterstützung in Abstufungen anbieten können: Dort kommt man mit bürgerschaftlichem Engagement weiter, hier mit Leuten, die einen speziellen Kurzkurs belegt haben, dort haben wir Pflegekräfte, die eine zweijährige Ausbildung nachweisen können, und wiederum woanders setzen wir hoch komplex oder spezial ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger ein.
Die Ziele sind also:
Erstens Staffelung der Dienstleistungen. Leider ist das zurzeit noch nicht der Fall. Noch versuchen wir, mit einem allgemeinen Angebot auf spezifische Bedarfe zu reagieren. Das klappt nicht, wie wir momentan auch in der Praxis erleben. Wir müssen ein System mit Angeboten auf verschiedenen Niveaustufen bereit halten. Das halte ich für wesentlich.
Zweitens sollten unsere Dienstzeiten flexibler organisiert und angepasst werden, und zwar entsprechend den Bedarfen und Stoßzeiten. Zum Beispiel braucht man in der Zeit von sieben bis neun Uhr morgens mehr Teilzeitkräfte als vorher. Bis zum Mittagessen reicht es wiederum aus, zu zweit auf der Station zu sein, dann kommt wieder eine Stoßzeit. In diese neuen Dienstpläne würde ich auch die ehrenamtliche Helfer deutlicher einbinden und die Zusammenarbeit mit ihnen ausbauen.
Nach der Einführung der Pflegeversicherung wuchs die Zahl der privat geführten Altenheime. Welche Auswirkungen hat dieser Trend auf Bewohner und Pflegepersonal?
Ob Arbeiterwohlfahrt, Caritas, das Rote Kreuz oder private Besitzer ein Altenheim führen, hat überhaupt keine Auswirkungen auf Bewohner und Pfleger. Es gibt private Heimbetreiber, die hoch kompetent und anerkannt sind, und Einrichtungen von Wohlfahrtsverbänden, die aufgrund der dort herrschenden Zustände schließen mussten. Natürlich behaupten die Wohlfahrtsverbände gern, dass die immer größere Zahl privater Heimbetreiber gefährlich sei für die Zukunft der Pflege, obwohl private Heime genauso der Heimaufsicht und dem Medizinischen Dienst unterstellt sind. Das Management und Wohlergehen aller in einem Heim hängt einfach von der leitenden Person ab und davon, ob die Financiers das Haus als Geldwaschanlage sehen oder nicht. Viele Skandale fanden nicht bei den privaten, sondern den Heimen der Verbände statt.
Damit wären wir bei Ihrer Forderung aus der Arbeitsgemeinschaft Menschen in Heimen, die Heime aufzulösen und die Betreuung wieder in die privaten Wohnungen zu verlegen.
Was würde es bedeuten, wenn alle Menschen, die in Heimen leben, wieder zu Hause wären? Ich habe es hochgerechnet und muss konstatieren, dass wir nicht alle 680 000 Menschen, die in Alteneinrichtungen leben, in betreute Wohngruppen zurückführen können. Denn es fehlen uns die Pflegenden. Damit kriegen wir diese komplette Rückführung nicht hin. Es bleibt eine Gruppe, die in relativ größeren Einheiten betreut werden muss. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Darüber hinaus gibt es Personen, die keiner betreuen will. Das muss man auch mal zugeben. Auch ich kenne solche Personen, die ich nie pflegen würde, selbst wenn ich in der Pflege verpflichtet wäre. Sie sind so schwierig, dass man sich ernsthaft überlegt, ob man sie wieder nach Hause holt und die Verantwortung für sie tragen möchte. Klaus Dörner hat den Mut zu sagen, dann müssen die eben alleine in der Wohnung bleiben, dann muss man ihnen ihr Persönlichkeitsrecht zugestehen. Das ist sicherlich richtig. Man dürfte viel häufiger den Mut haben, Menschen so zu lassen, wie sie sind, und könnte ihre Betreuung erst mal mit Hilfe des nachbarschaftlichen Engagements abdecken.
Sollte das Thema Ethik sowohl in der Ausbildung als auch in der Praxis einen größeren Raum einnehmen?
Wir brauchen Pflegende, die sehr klar reflektieren können. Deshalb hat Ethik schon in der Ausbildung ein großes Gewicht sowie in unserem Institut, in dem wir auch einen Lehrstuhl für Ethik in der Pflege haben.
Für ethische Diskussionen muss man aber nicht immer eine separate Situation schaffen. Am besten ist die Auseinandersetzung in der Alltagssituation. Man trifft sich zum Beispiel bei der mittäglichen Übergabe und teilt mit, dass Frau x nicht mehr essen will. Das ist jetzt eine ethische Fragestellung, auch wenn die Kolleginnen sie im ersten Moment nicht als eine solche identifizieren. Sie müssten jetzt nämlich klären, ob Frau x schon vorher etwas dazu gesagt hat, ob sie eine Patientenverfügung formuliert hat und was die Angehörigen wissen oder mitentscheiden möchten. Ist das Ganze jetzt eher eine Frage der Ethik oder eine Frage der Ernährung? Dies entscheiden zu können, macht die professionelle Herangehensweise aus.
Die Überprüfungen der Altenheime obliegen der Heimaufsicht und werden angemeldet. Wie stehen Sie zur dieser Praxis?
Die Heimaufsicht ist sicherlich sehr wirksam, wenn sie gut besetzt ist, und kaum wirksam, wenn sie mit zu wenigen und nur mäßig kompetenten Mitarbeitern besetzt ist. Es hängt auch hier von den Menschen ab und davon, ob sie ihren Auftrag sehr ernsthaft oder nicht so ernsthaft wahrnehmen. Natürlich ist die Struktur desolat, aber es ist in keinem Bereich besser organisiert: Das Gesundheitsamt meldet seinen Besuch im Krankenhaus an, der Schulrat erscheint auch nicht unangemeldet im Lehrerzimmer. Alle bereiten sich auf solche Visiten vor.
Ich finde in diesem Zusammenhang eher problematisch, dass es allgemein immer mehr Kontrollgremien werden. Wenn es in Deutschland ein Problem gibt, richtet man eine Kontrollinstanz ein, ändert aber nichts an den Strukturen. Man guckt nicht, woran es gelegen hat, sondern entscheidet lediglich, noch einen Kontrolleur mehr herumlaufen zu lassen.
Vor der Einführung der Pflegeversicherung wurde mal viel Hoffnung in sie gesetzt, weil durch sie die Menschen von der Sozialhilfe loskommen würden. Wie sehen Sie ihre Existenz und ihre Auswirkungen heute, nach zehnjähriger Praxis?
Man muss ganz ehrlich sagen, die Menschen rutschen nicht mehr so früh in die Sozialhilfe, sie rutschen aber wieder dorthin, je länger der Pflegebedarf besteht. Das Versprechen ging nicht auf, dass sie nicht mehr in die Sozialhilfe kommen. Je länger es bestehen bleibt, dass die Pflegeversicherung auf nur 1,7 % festgeschrieben ist und die Krankenversicherung auf 15 %, desto größer wird das Problem mit jedem weiteren Jahr.
Frauen werden im Durchschnitt 24 Monate in ihrem Leben pflegebedürftig, Männer 17 Monate. Das waren Ergebnisse letzter Erhebungen, von daher kann man ja ausrechnen, dass man mit dem Geld aus der Pflegeversicherung allein nicht hinkommt.
Mich beschäftigt aber ein anderer Umstand viel mehr, eine Frage, die mir noch nie ordentlich beantwortet wurde: Ich frage mich immer, was die Heimleitungen mit dem vielen Geld machen. Die erzählen mir dann immer, sie würden es für die Qualitätskontrolle brauchen sowie für die Heimaufsicht, den Brandschutz, Hygieneverordnungen und so weiter. Deshalb brauchten sie so viel und kämen mit dem Geld dennoch nicht aus.
Ich finde die Diskrepanz eklatant: Ein Heim bekommt viel Geld, aber wo bleibt die Qualität für die Leute, die da leben?

Die heimfreie Gesellschaft – Utopie oder Realität des 21. Jahrhunderts?
Ein Interview mit Klaus DörnerAls Mitinitiator der Reformbewegung in der Psychiatrie und als Einziger in Deutschland organisierte Prof. Dr. med. Klaus Dörner als Leiter (1980 bis 1996) der Westfälischen Klinik für Psychiatrie Gütersloh die Auflösung der dortigen geschlossenen stationären Abteilung und den Umzug der bisherigen Patienten und Bewohner in eigene Wohnungen oder Wohngemeinschaften im Ort. Dort wurden sie je nach Bedarf weiterhin betreut, nun durch ambulante Dienste. Klaus Dörner ist u. a. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Menschen in Heimen, die sich für die Einrichtung einer Bundestagskommission Enquete der Heime einsetzt. Diese Enquete möge das bestehende Heimsystem grundsätzlich überprüfen und klären, ob es heute noch den Belangen der Alten, Pflegebedürftigen, Behinderten und Kranken angemessen ist oder durch Alternativen ersetzt werden kann.
Sie fordern die Abschaffung aller Altenheime – warum?
Unsere derzeitige Entwicklung zeigt, was geschieht, wenn die Forderung weniger radikal ist und nur lautet: So wenig Heime wie möglich. Dann nämlich passiert Folgendes: Man fängt für die relativ selbstständigen Menschen an, ambulante Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen, und betreut in Heimen nur noch die allerschwierigsten, chancenlosen, pflegeabhängigen und bettlägerigen Menschen. Diese Konzentration von Schwer- und Schwerstbedürftigen führt irgendwann in die Unerträglichkeit und die totale Menschenunwürdigkeit, sowohl für die Betroffenen als auch für die Mitarbeiter. Dieser Weg ist also nicht gangbar und muss im Keim erstickt werden, indem man die Forderung radikalisiert – und zwar aus rein pragmatischen, nicht aus ideologischen Gründen. Das Denken und Handeln muss immer bei den Schwächsten ansetzen, bei denen, die der Pflege am meisten bedürfen, nicht bei den teilweise noch selbstständigen Menschen.
Bisher wird dieses Modell einer ausschließlich ambulanten Betreuung in Schweden und Norwegen, teilweise auch in Dänemark und Finnland, praktiziert, wenn auch bisher nur für die Behinderten und psychisch Kranken. Diese Länder beweisen, dass es bei entsprechend anderer Organisation für ein ganzes Land auch ohne Heime geht.
Aber genau diese Sorge um die schwächsten und pflegebedürftigen Mitglieder einer Gesellschaft hat die europäischen Länder vor 200 Jahren das Heim erfinden lassen. Seitdem können sie diese Menschen wieder versorgen und sich dabei noch rühmen, soziale Verantwortung zu übernehmen.
Genau, vorher hat es in der gesamten Menschheitsgeschichte nie Heime gegeben. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, mit der Industrialisierung der Arbeit, wurde das Arbeiten der Menschen vom Wohnen getrennt. Vorher gehörten Wohnen, Arbeiten und das Lösen sozialer Probleme zu einem Haushalt, dem alteuropäischen Oikos, in dem sich die Aufgaben miteinander verbinden ließen. Mit der Industrialisierung wurde das Arbeiten aus dem Haushalt herausgelöst und in Fabriken institutionalisiert. Weil nun aber die pflegebedürftigen Menschen unversorgt allein zu Hause blieben, mussten systematisch soziale Institutionen geschaffen werden. So sind die flächendeckenden Netze von Altenheimen, Jugendheimen, Behindertenheimen und Heimen für psychisch Kranke zustande gekommen.
Konnten nicht die übrigen Mitglieder der Großfamilien diese Aufgaben übernehmen? Es waren doch nicht immer alle Erwachsenen in den Produktionsprozess eingebunden.
Die so genannte Großfamilie gab es nur vereinzelt bei den agrarischen und städtischen Oberschichten, und schon deshalb war der vormoderne Haushalt nur mit Unterstützung und Hilfe der Nachbarschaft voll funktionsfähig. Haushalt ohne Nachbarschaft zu denken war den Menschen früher gar nicht möglich. Nur durch sie konnten in der gesamten Menschheitsgeschichte überdurchschnittliche Hilfe und Pflegebedarf abgedeckt werden.
Nun musste aber auch ein Großteil der Nachbarschaft in die Fabriken gehen, und so ist diese in der Menschheitsgeschichte völlig abnorme, perverse Idee aufgekommen, alle Pflegebedürftigen von einer Sorte an einem Ort zu konzentrieren, an dem sie dann in möglichst großer Stückzahl seriell – parallel zur Produktion in den Fabriken – und fließbandartig betreut werden.
Das Heim kann ja so schlecht nicht sein, wenn es seit gut 200 Jahren seine Funktion erfüllt und offensichtlich auch akzeptiert und genutzt wurde.
In der Anfangszeit hat es die Menschen sehr zur Verzweiflung gebracht, erst allmählich konnten sie die Vorteile sehen. Denn in der Institution Heim wurde das Helfen professionalisiert, haben sich Spezialisten fürs Helfen entwickelt, und mit dieser Professionalisierung wurde das Helfen das erste Mal bezahlt. Ich helfe zwar nicht gern – meist höchst widerwillig, zähneknirschend –, doch ich muss es ja tun. Aber Geld dafür nehmen? Ein bis dahin völlig unvorstellbarer Gedanke. Doch da die Fließbandarbeit bezahlt wurde, mussten auch die Spezialisten fürs Helfen bezahlt werden. So sind die sozialen Berufe entstanden.
Diese Spezialisten und ihr Fachwissen haben sowohl dem System Heim als auch dem Einzelnen Vorteile gebracht, oder nicht?
Die Verheimung war nach 100 Jahren relativ gut akzeptiert, weil sie die Produktivitätssprünge der Wirtschaft mit der Erhöhung des Lebensstandards für jeden Einzelnen erlaubte, der wiederum durch hinreichende Zahlungen von Steuern und Beiträgen dieses Heimsystem finanzierte. Die Solidarität der Bürger wurde von Zeitgeben auf Geldgeben umgestellt. Dabei gewannen sie Freiheit und Freizeit, also eine Zeit völlig frei von sozialen Problemen.
Auch die, die in den Heimen lebten, fanden es akzeptabel, und zwar deshalb, weil das Heim eine einigermaßen erträgliche Mischung von Fitten und weniger Fitten aufwies. Die verhältnismäßig Selbstständigen fühlten sich gebraucht und waren zugleich billige Arbeitskräfte. So kam man mit ganz wenig Personal aus und konnte die Heime finanzieren. Dieses Prinzip der gesunden Mischung ist unter Insidern das am besten gehütete Geheimnis gewesen und nur wenig in die Öffentlichkeit gedrungen. Um 1900 konnte man also von einem Akzeptanzgipfel sprechen, doch seither ist die Akzeptanz wieder zurückgegangen.
Welche Gründe sind es denn gewesen, die zu einem Meinungsumschwung führten?
Es gab nicht mehr genügend vitale Menschen, die mitarbeiten konnten, und auch nicht mehr genug, die mitarbeiten wollten. Da der Freiheitsgewinn von allen als ein allgemeiner Standard empfunden wurde, sind immer weniger Menschen bereit gewesen, bei Pflegebedürftigkeit in ein Heim zu gehen und damit ihr Selbstbestimmungsrecht abzugeben. Das heißt, die Bürger haben sich zunehmend geweigert oder sind immer später ins Heim gegangen. So ist die gesunde Mischung kaputt gegangen und das Heim zwangsläufig immer weniger akzeptabel geworden.
Außerdem wurde die Mitarbeit der Fitteren besonders in der 68er Emphase als allerschrecklichste Ausbeutung beschimpft, sodass alle Heimträger sich schnell bemühten, es abzuschaffen. Das erste Altenheimgesetz von 1974 hat dann tatsächlich jegliche Form der Beschäftigung von Heimbewohnern, zum Beispiel in der Küche, radikal verboten. Jetzt wurde die entsetzliche Leere und lähmende Untätigkeit für den Einzelnen noch größer. Diese Leere mit therapeutischen Basteleien zu füllen, das kann kein Mensch als wirklichen Sinn seines Lebens empfinden.
Sich versorgt fühlen und seinen Tag in Muße zu verbringen, ist das nicht das heute propagierte Ideal eines erfüllten Lebensabends?
Ich denke, die Menschen haben zwei Grundbedürfnisse, einmal das bekannte nach Selbstbestimmung, Selbsterhaltung, Selbstverwirklichung, zum anderen das Grundbedürfnis, Bedeutung für andere zu haben. Erst diese Bedeutung gibt eine Berechtigung zu leben, gibt dem Leben einen Sinn. Das Wichtigste für einen Menschen besteht nicht darin, irgendwo zu wohnen, sondern etwas für sich und andere Menschen Sinnvolles zu tun. Solange das im Heim gewährleistet war, war es noch einigermaßen akzeptabel. Zwar abnorm, aber immerhin noch akzeptabel.
Nun ist diese Funktion des Heims verloren gegangen, einmal durch das Wegbleiben der noch gesunden Bewohner, zum anderen durch das Agieren der Heimbesitzer selbst. Die Heimbetreiber haben nämlich am Untergang ihrer Heime selbst mitgearbeitet, indem sie den veränderten Bedürfnissen, zum Beispiel dem Freiheitsstreben, mehr entsprechen wollten und ihrerseits Alternativen wie Altenpflegestätten, Wohngruppen oder ambulante Betreuungen geschaffen haben. Dort lässt es sich besser leben, wohingegen das Heim nun zu einer immer unerträglicheren Konzentration von Sterbenden oder Schwerstpflegebedürftigen wird. In dieser Entwicklungsphase befinden wir uns heute.
Im Jahr 2001 hatten wir insgesamt 2,04 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland zu betreuen. Im Jahr 2020 werden es schon 2,83 Millionen sein, das bedeutet einen Anstieg der Pflegebedürftigen um mehr als ein Drittel. Gleichzeitig gibt es immer weniger Junge, die diese Alten versorgen können. Ist es nicht unsere Pflicht, ihnen durch garantierte Heimplätze wenigstens die Grundpflege zu sichern?
Wenn man die Zunahme der alten Menschen mit der Zunahme von Heimplätzen wie bisher beantworten würde, dann würde das nach mindestens zwei, drei Jahrzehnten in die völlige Unbezahlbarkeit führen. Denn niemand hat damit gerechnet, dass die Menschen immer älter und pflegebedürftiger werden.
Dann bleibt nur die rückwärts gewandte Lösung, dass die Pflegebedürftigen wieder zu Hause versorgt werden?
Wir müssen gewissermaßen allen Bürgern die Denksportaufgabe stellen, einen dritten Weg zu finden. Den Weg zwischen der Betreuung zu Hause, die nach wie vor die Nummer eins ist für 70 Prozent der Pflegebedürftigen, und dem Heim. 70 Prozent der Menschen, vor allen Dingen die Frauen, quälen sich ja mit den Pflegefällen ihrer Familien ab. Das wird im gewissen Umfang so bleiben, wenn auch mangels Kindern quantitativ abnehmen. Die Hauptlast wird also der eigene Haushalt tragen, für den die Betreuungsmöglichkeiten verbessert werden müssen. Außerdem wird im gewissen Umfang für bestimmte Bedürfnisse das Heim bleiben, das aber nie mehr flächendeckend sein kann. Für die Masse der Pflegefälle muss man einen dritten Weg einschlagen. Zurzeit scheinen die Hausgemeinschaften die beste Verwirklichung dieser Suche nach einer neuen Lösung zu sein.
Ich benutze am liebsten den Begriff Haushaltsgemeinschaften, weil es die Arbeit impliziert und man den Leuten sagen kann, ihr habt bisher einen Haushalt geführt, und wenn das in den eigenen vier Wänden nicht mehr geht, dann kann es in der Wohngruppe um die Ecke gehen, wo ihr gemeinschaftlich von Professionellen unterstützt werdet. Das gibt Lebenssinn und Lebensgefühl, was der Mensch ebenso sehr braucht wie Selbstbestimmung.
Selbst namhafte Institutionen wie das Kuratorium Deutsche Altershilfe und die Bertelsmann Stiftung setzen sich vehement für die Alternative des betreuten Wohnens ein. Gleichzeitig hält sich die Bundesregierung zurück; sie hat bisher noch keine positive Stellungnahme abgegeben. Woran liegt das?
Man wird nicht vorschnell diese Verheimung, die über 150 Jahre lang funktioniert hat, ad acta legen. Man wird krampfhaft an dieser Problemlösung festhalten. Außerdem gibt es den Begriff des ambulanten betreuten Wohnens im Sozialhilfegesetz noch nicht. Er ist erst von den sparsamen Schwaben in Baden-Württemberg im Jahre 1979 erfunden worden. Bis 1980 hieß es, dass Pflegebedarf, der nicht in den eigenen vier Wänden von der Familie abgedeckt werden konnte, nur im Heim, also vollstationär, möglich ist. Es ist also nur 25 Jahre her, seitdem man etwas anderes anbieten kann als Heimunterbringung, und deshalb denken die meisten noch so wie früher.
Die Alten-Wohngemeinschaften haben massive Probleme mit Heimaufsichtsbehörden, Krankenkassen und Sozialhilfeträgern. Sie kämpfen ums Überleben, weil sie teuer sind, nur wenige Betroffene sie sich leisten können und es zu wenig Helfer und Fachpersonal gibt. Welches wären die nächsten Schritte auf dem Weg hin zu mehr kommunalen Wohnangeboten?
Das Klagen dieser Wohngemeinschaften gehört zum Geschäft und ist berechtigt, weil sie versuchen, einem seit 150 Jahren eingeschliffenen System Paroli zu bieten. Dazu kommt ihr Problem mit den Einnahmen. Hier sehe ich als Historiker die einzige Chance, an die Bürger zu appellieren: Wenn ihr nicht mehr mit Geld das bezahlen könnt, was wir alle brauchen, und obendrein der Bedarf größer wird, dann müsst ihr in einer anderen Währung, der Zeitgabe, rechnen. Und für mich liegt der Kern der Problemlösung darin, es zu einer immer normaleren Sache werden zu lassen, dass die Bürger in noch zu organisierender Form einen Teil ihrer Zeit dem Helfen zur Verfügung stellen, also in altdeutscher Sprache, wieder eine Nachbarschaftsmentalität entwickeln.
Kaum ein Mensch ist aus freien Stücken bereit, seinen Anteil an der Versorgung solcher Alten- und Krankengemeinschaften zu leisten. Wie bewegt man den Einzelnen, es dennoch zu tun?
Es ist richtig: Menschen werden nie freiwillig gern helfen. Immer, wenn sie aufgefordert werden, das zu tun, wird ihnen garantiert etwas einfallen, was viel schöner oder wichtiger ist und was sie in derselben Zeit tun könnten. Mit dem moralischen Appell kommt man nicht weiter.
Wir packen sie an ihrem zweiten Grundbedürfnis, nämlich für andere Bedeutung haben zu wollen. Aber auch damit ist nicht a priori gewährleistet, dass ich das Helfen als mein primäres Bedürfnis empfinde. Ich tue es meist widerwillig, gegen meinen egoistischen Willen, und nur über den Umweg, dass das, was dem anderen gut tut, dann auch mir gut tut. Nur so kann ich es mir als mein soziales Bedürfnis einreden.
Heutzutage fühlen sich viele Menschen nicht mal für die Mitglieder ihre Kleinfamilie verantwortlich und überhören die Hilferufe derer, die ihnen am nächsten stehen. Dieselben sollen sich nun sogar um fremde Menschen kümmern – ist das nicht lediglich ein frommer Wunsch?
Nein, denn was das Helfen angeht, ist man bezogen auf die eigene Familie gewissermaßen instinktgesteuert. Wenn jemand Hilfe braucht, dann hilft man. Menschheitsgeschichtlich hat es ja einen gewissen Dunstkreis außerhalb des eigenen Haushalts gegeben, Nachbarschaft genannt, wo diese Instinktprägung zwar nicht so stark, aber auch noch vorhanden, mobilisierbar war. Dieser Einsatz war und ist aber an eine territoriale Grenze gebunden, die mit dem Begriff Nachbarschaft beschreibbar ist. In dieser Nachbarschaft kann ich sagen, das ist mein Dorf, mein Stadtviertel, und wenn da Demente leben, dann sind das meine Dementen, die haben mit mir zu tun, die nehme ich anders wahr, da bin ich auch bereit, mich in einem gewissen Umfang für krumm zu machen. Diese "Übersetzungsleistung" ist aber extrem stark gebunden an ein bestimmtes Territorium, zehn Meter drüber hinaus funktioniert sie schon nicht mehr. Sie funktioniert nur über diese territoriale Grenzziehung.
Für die meisten gibt es das Eingebundensein in Nachbarschaft gar nicht. Viele leben isoliert, atomisiert, für sich oder als Familie allein. Sie denken noch nicht mal daran, ihre eigene Altersversorgung zu organisieren ...
... das ist das Begreiflichste von der Welt: Etwas, das mit Nachteilen für mich verbunden sein kann, das werde ich, wenn ich nicht gezwungen werde, ausblenden, und zwar egal, ob es meine Eltern betrifft oder mich selbst. Deswegen ist ja auch die Forderung, die Leute sollten fürs Alter vorsorgen, eine völlig abnorme Forderung. Kein Mensch kann sich dazu bequemen, das ganze Leben daran zu denken, was im Alter auf ihn zukommt. So funktionieren Menschen nun mal. Das ist normal. Deswegen werden die Bürger auch nur annäherungsweise für ihr Alter vorsorgen, aber nie in dem eigentlich erforderlichen Ausmaß, weil die Menschen sich Gott sei Dank dafür blind machen und ihr Leben genießen, solange es zu genießen geht. Wenn Sie mich fragen, ich mache es genauso. Es würde einem das Leben vergällen.
Ich bin meiner Zukunft gegenüber unempfindlich, aber offen gegenüber den aktuellen Nöten der Menschen in meiner Nachbarschaft? Ein altruistisches Ideal, ganz und gar unzeitgemäß.
Ich wäre nicht so überzeugt, wenn ich nicht in Gütersloh diese Erfahrungen gemacht und gesehen hätte, dass die komplette, die vollständige Integration aller psychisch Kranken, auch der unsympathischen, verhaltensauffälligen Behinderten, die ja alle in unserer Anstalt gesammelt waren, gelungen ist. Die Bürger dieser Stadt und später des ganzen Landkreises konnten hinreichend Nachbarschaftsmentalität entwickeln und die Integration der Kranken und Behinderten mittragen. Das äußerte sich in der Haltung zu sagen, das sind unsere Dementen. Gleichzeitig sollen die anderen Dementen bleiben, wo der Pfeffer wächst.
Die Integration in Gütersloh mag gelungen sein, sie wurde der Gemeinde, die mit dem Beschluss der Klinik konfrontiert wurde, jedoch eher aufgezwungen. Wie wollen Sie die Leute von heute mit dieser Nachbarschaftsmentalität impfen?
Ein wirklich neues Denken funktioniert nie von oben herunter, es muss von unten wachsen. Die Impulse sind in großer Zahl schon da, etwa seit 1980, seit wir kein nennenswertes ökonomisches Wachstum mehr haben, aber sie lesen nie etwas davon in den Zeitungen. Völlig gegen den behaupteten Zeitgeist wächst jährlich die Zahl der Bürger, die sich für freiwillige Tätigkeiten interessieren. Zum Beispiel sind in den letzten 20 Jahren Hunderte von Nachbarschaftsvereinen entstanden. Oder die Hospizbewegung: Absurd, dass es Menschen gibt, die sich geradezu darum reißen, sich mit dem größten Tabu zu beschäftigen, mit Sterben, Leiden, Tod. Auf rein freiwilliger Basis ist auf ambulanter Basis ein flächendeckendes Netz von Hospizen entstanden. Darauf hat sich dann erst die Professionalisierung mit den stationären Hospizen und der Palliativen Medizin draufgesattelt, denn die Profis möchten ihren Reibach machen, dabei sich stützend auf eine total freiwillige Bürgerbewegung. Einer Bewegung, die erkannt hat, dass man vor dem Altern und Sterben nicht die Augen schließen kann.
Ebenso sind seit den siebziger Jahren die Kitas und Gesundheitsläden entstanden, es ist nichts anderes als praktizierte Nachbarschaftshilfe im eigenen Viertel. Wir müssen dahin kommen, dass die Kultur meines Viertels nicht nur genügend Kindergartenplätze, sondern auch eine hinreichende Zahl von Alterspflege- und Dementenplätzen verlangt.
Kultur hin oder her, die Gemeinden und Behörden sagen, die Töpfe sind leer. Wir können euer Problem nicht lösen.
In Zeiten, in denen unser Geld allein nicht mehr reicht, um Profis die Arbeit übernehmen zu lassen, und wir in irgendeiner Form auch selbst wieder in die Bütt müssen, kann man sich über die Währung Gedanken machen, mit der wir einspringen, das heißt, ob wir Zeit geben oder ob wir für unseren Einsatz Geld bekommen:
Wir könnten einen Teil unserer Abgaben wieder zurückholen und das Geld den Profis nicht mehr geben, weil die zu teuer geworden sind, und es stattdessen selber und auch noch billiger machen. Gekoppelt mit der Frage, ob es nicht relativ einfache Pflegeleistungen gibt, die wir wieder zurückholen können, gemeinsam mit dem dafür ausgegebenen Geld. Damit verschaffen wir uns eine Einnahme, zumal wir auf dem Arbeitsmarkt sowieso keine mehr erzielen können. Eine ganz wichtige Überlegung, die übrigens im Landkreis Schwandorf an der tschechischen Grenze stark ausgeprägt ist. Dort versuchen vier ambulante Pflegedienste beziehungsweise Sozialstationen der Caritas, die Bürger in diese Richtung zu mobilisieren.
Es gibt auch noch andere als finanzielle Gründe, Heime zu schließen. Eine Tatsache ist: Wer ins Heim kommt, kommt dort meist nur tot wieder heraus, nicht weil er schon so alt und schwach ist, sondern weil das Heim ihn in den Tod treibt. Woran liegt das?
Es ist das bekannteste Faktum überhaupt, dass ein bestimmter Prozentsatz, der ins Heim kommt, an der Heimverlegung stirbt. Es ist das Heim selbst, das die Menschen tötet, völlig unabhängig von der Anzahl der Pflegekräfte. Denn die Verheimung von Menschen ist eine menschentötende Veranstaltung. Das hat noch nie jemand bestritten.
Könnten Sie beschreiben, wie es zu solch einer letztendlich lebensbeendenden Entwicklung kommt?
Wenn ich plötzlich und unfreiwillig doch in ein Heim komme, dann verschlägt mir dieser totale Umbruch aller meiner Lebensbezüge nicht nur die Sprache, sondern auch den Appetit. Das äußert sich dahingehend, dass ich zu wenig esse und trinke. Gleichzeitig greift die Selbstbestimmungsideologie, die sagt: Wenn der Mensch nicht mehr isst, dann ist das Ausdruck seiner Selbstbestimmung. Er möchte nicht mehr essen, er möchte sterben. Und dann wird mir beim Eintritt ins Heim eine Patientenverfügung abgeknöpft – immer häufiger machen Heimbetreiber diese zur Bedingung, um Verfahrenssicherheit zu haben –, in der steht, wenn ich dement werde, möchte ich auch nicht, dass irgendwas Lebenserhaltendes mehr gemacht wird. Ich sterbe, und angeblich hat man meine Selbstbestimmung respektiert. In Wirklichkeit hat mir nur die Aufnahme ins Heim den Appetit verschlagen.
Das ist der Grund, warum in den alternativen Dementen-WGs mit der Ernährung so ein Kult betrieben wird. Denn alles, was mit Ernährung zu tun hat, bekommt im Alter eine ähnlich zentrale Bedeutung wie im Kleinkindalter.
Das Heim – ein Ort, der einem den letzten Lebensfunken ausbläst/nimmt?
Ich denke, man tut gut daran, diese mörderische Funktion von Heimen im Allgemeinen stärker herauszuarbeiten. In einem Heim geht man nie mit einem Einzelnen um, sondern immer mit allen zusammen, mit der Gesamtheit der Gruppe. Im Rechtssystem ist aber immer nur der Einzelne geschützt. Das heißt, das Rechtssystem wird selten ein Heim verklagen, weil die konkreten Handlungen an einem Einzelnen so gut wie nie festzumachen sind.
Im Grunde genommen ist das Heim eine kriminelle Vereinigung, die mit der Absicht gegründet worden ist, die Kriterien des Strafrechts möglichst geschickt zu umgehen. Wenn man eine Gruppe von Menschen, denen man eine negative Eigenschaft zuschreibt, aus ihrer normalen Lebenswelt herausnimmt, sie selektiert und homogenisiert und sie dann lebenslänglich konzentriert, dann wird diese Gruppe genau durch dieses Vorgehen an Wertschätzung verlieren. Natürlich auch an Selbstwertschätzung, ob sie wollen oder nicht. Und das führt in Krisenzeiten dazu, dass auch die Gewalthemmschwelle der Bevölkerung gegen sie sinken wird.
Solche Behandlung verstößt doch gegen das Grundgesetz, gegen das Recht auf Menschenwürde und ein selbstbestimmtes Leben?
Wenn man sich das Grundgesetz zu dem Thema Verheimung von Menschen durchliest, dann wird man zu dem Ergebnis kommen müssen, dass es sich hier um ein so genanntes besonderes Gewaltverhältnis handelt, weil Persönlichkeitsrechte eingeschränkt werden. Besondere Gewaltverhältnisse sind mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Die Grundgesetzväter erlaubten es dennoch, unter der Bedingung der alternativlosen Erforderlichkeit. Solange also die ambulante Form des Betreuens unbekannt war, konnten sich alle auf diese Entscheidung berufen, denn es gab keine Alternative. Aber seit dem Geniestreich der Schwaben im Jahre 1979 gibt es implizit andere Lösungen. Und wenn wir uns nun nicht strafbar machen wollen, müssen wir alles tun, damit diese Alternativen zum Zuge kommen und das besondere Gewaltverhältnis immer weiter zurückgefahren wird, bis es zum Schluss nicht mehr da ist. Ich gehe so weit zu sagen: Jeder, der sich nicht darum bemüht, macht sich strafbar.

Vorschläge und Anregungen für ein menschliches, würdevolles Leben im Alter
Ich war ausgezogen, um den Arbeitsalltag in Altenheimen kennen zu lernen und zu erfahren, ob es sich bei den Pflegemissständen um Ausnahmen oder die Regel handelt. Ich bin zurückgekommen mit der Erkenntnis, dass Leben und Arbeiten in Heimen fast immer unerträglich sind. Sicher gibt es Heime, die mit hohem individuellen und idealistischen Einsatz versuchen, das Leben in ihnen angenehm zu gestalten. Doch ändern auch sie nichts an der Tatsache, dass das Heim als Institution menschenunwürdig ist, in ihm die Grundrechte der Menschen potenziell bedroht sind und es keine adäquate Lösung für die Versorgung pflegebedürftiger älterer Menschen im 21. Jahrhundert ist.
Unsere Vorschläge und Forderungen zielen auf die Bewältigung der aktuellen Doppelaufgabe, die real existierenden Missstände in den vorhandenen Heimen abzuschaffen und parallel dazu ein alternatives ambulantes Hilfesystem aufzubauen, das die Heime fast vollständig überflüssig macht. Diese ambulante Versorgung ist und wird Bestandteil einer neu zu entwickelnden Community Care, eines Sorge-Netzes aus vielen Anbietern wie den ambulanten, kommunalen Einrichtungen, privaten Pflegediensten, wenigen Heimen und den Bürgern, die sich sozial engagieren.
Lösungsvorschläge:
Fusion von Pflege- und Krankenversicherung
2001 empfahl die Enquete-Kommission Demografischer Wandel des Deutschen Bundestages, die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung zusammenzulegen. Beide Systeme müssten dann durch niedrige Beiträge um ihre Mitglieder wetteifern und würden sich mehr um Effektivität denn um den Erhalt verkrusteter Strukturen bemühen. Die Krankenkassen würden sich stärker um Präventionsmaßnahmen kümmern, damit die kostenintensivere Pflegebedürftigkeit gar nicht erst entsteht.
Sozialbilanzen der Kranken- und Pflegeversicherung
Die Fusion beider Kassen wäre eine gute Voraussetzung, ist aber nicht zwingend, um folgendes Kontrollsystem zu etablieren: Die Anzahl der Pflegekräfte, für die Krankenkassenbeiträge gezahlt werden, wird verglichen mit der Anzahl der Pflegekräfte, die von den Heimen als notwendige Mitarbeiter gemeldet und von der Pflegekasse pro Heim bezahlt werden. Bei den Krankenkassen lassen sich anhand der gezahlten Krankenkassenbeiträge alle tatsächlich eingestellten Mitarbeiter eines Heimes auflisten. Die Pflegeversicherung summiert anhand der Dokumentationen der Heimbewohner die von ihr bezahlen Pflegestunden und damit die Anzahl der finanzierten Pflegerinnen und Pfleger pro Heim. Eine Differenz dokumentiert Betrug und könnte zum Stopp der Auszahlungen führen sowie Geldstrafen und Prozesse nach sich ziehen.
Sukzessiver Abbau von Heimplätzen
Sukzessive Schließung aller Heime durch Einrichten kleinerer Verwaltungseinheiten mit maximal 20 Bewohnern. Denn die Institution Heim:
- ist mit lebenslänglichem "open end" und schneidet von der Zukunft ab.
- erfasst einen Menschen total.
- sortiert sie nach bestimmten Defiziten, was chronisches Leiden fördert.
- verunmöglicht ein Leben nach dem Grundsatz: "Es ist normal, verschieden zu sein." (R. v. Weizsäcker)
- lässt eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben nicht zu
- fördert passives Verhalten und die Angst, dass Kritik zu persönlichen Nachteilen führt. Daraus resultiert eine
- unreichende psychiatrische Versorgung.
- schränkt fast alle Grundrechte ein, alleine schon durch die Hausordnungen.
- hat im Konfliktfall immer Vorrang vor dem Individuum.
- lässt den, der sich nicht anpasst, "fürsorglichen Zwang" erfahren
- missachtet den Vorrang der Rehabilitation
- ist eine Gemeinschaft der Ausgeschlossenen.
Größeres Angebot an Alten-WGs und ambulanten Versorgungseinrichtungen
Gemeinsamer Nenner von Dementen-WGs: die familienähnliche Struktur und eine an der Normalität orientierte Organisation des Tagesablaufs. Aufgrund folgender Vorteile werden sich die stationären Wohnformen und Pflegemodelle in der Zukunft behaupten:
- Das Selbstbestimmungsprinzip des Kunden bleibt gewahrt darüber:
- wer Pflege und Betreuung bereitstellt
- wie Pflege und Betreuung strukturiert sein sollen
- mit wem die Wohnung geteilt wird (keine "Personenneutralität" wie im Heim)
- wie die Wohnung ausgestattet wird
- was gegessen und getrunken wird etc.
- welcher Pflegeanbieter ausgewählt wird
- Integration in das Wohnviertel
- Ausstattung und Tagesabläufe wie im privaten Haushalt
- Beteiligung von Angehörigen im Haushalt und an der Pflege
- Beteiligung der Krankenkassen als Kostenträger behandlungspflegerischer Maßnahmen, da es sich sozialrechtlich der eigene Haushalt ist, in dem gelebt und versorgt wird.
- Beteiligung der Bewohner am Haushalt (Kochen, Einkaufen, Reinigung etc.)
Langzeitvorteile des integrierten Wohnens:
- Vermeidung von Heimunterbringung, wenn diese gar nicht notwendig ist
- Prävention durch optimalen Erhalt alltagsweltlicher Kompetenzen
- Vermeidung von Psychopharmaka-Gaben
- kein Burn-out-Syndrom bei den Pflegekräften
- keine Überforderung der pflegenden Angehörigen:
Abschaffung des bestehenden Pflegestufen-Modells und Abrechnung nach individuellen Bedürfnissen
Pflegezustände müssen umfassend sein, also die psychosoziale Betreuung einschließen und nicht überwiegend körperpflegeorientiert bewertet werden. Der derzeitig angewandte Pflegebegriff ist unzureichend, zu wenig ganzheitlich und durch die vorgegebenen Zeitkorridore erheblich beschränkt. Das System der Zeitkorridore macht eine dem Patienten angemessene Pflegebehandlung auch deshalb unmöglich, weil in einen Zeitkorridor nicht mal die Hälfte aller notwendigen Betreuungsschritte fällt. Pflegehandlungen sind sehr heterogen. Sie unterscheiden sich nicht nur von Fall zu Fall, sondern auch von Situation zu Situation. Für jeden Pflegebedürftigen ist ein individueller Pflege- und Heilplan zu erstellen, der dem tatsächlichen Bedarf folgt – und nicht danach ausgerichtet ist, was Pflegeeinrichtungen gerade zu bieten haben. Eine Kategorisierung von Menschen und Krankheiten in drei Stufen wie zurzeit muss zu Ungerechtigkeiten und unangemessener Behandlung führen.
Das geltende Pflegestufenmodell bedeutet: Je pflegebedürftiger, desto teurer – und beeinflusst die Bilanzen der Heime. Je mehr Bewohner mit Pflegestufe III im Haus liegen, desto mehr Einnahmen werden verbucht. Diese werden nicht freiwillig zurückgeben beziehungsweise als zu viel deklariert, selbst wenn sich der Gesundheitszustand einiger Bewohner verbessern sollte. Die bisherige Konsequenz: Gute Pflege wird bestraft und schlechte belohnt.
Dokumentationspflicht der Heime
Die stationären Pflegeeinrichtungen müssen gesetzlich verpflichtet sein, die Geschäftsabläufe transparent, differenziert und nachvollziehbar mindestens einmal pro Jahr der Öffentlichkeit darzulegen. Dazu zählen:
- Aufstellung erhaltener Pflegesätze entsprechend der Einstufung der Bewohner
- Zusammensetzung der Entgelte für Kost und Logis sowie detaillierte Kostenaufstellungen bei Erhöhungen der Pauschalen
- Jahresbilanzen, die für Behörden, Finanzamt- und Bewohnernachfragen jederzeit einsehbar sein müssen
- Kostenaufstellung entsprechend der Bewohneranzahl, welche betriebswirtschaftlich nachvollziehbar sein müssen und nach den Grundsätzen der Wahrheit und Klarheit zu führen sind, somit:
- Abschaffung der Selbstkostenblätter der Heime Bisher halten die Heime die Kalkulation der im Haushalt anfallenden Kosten in Form von Selbstkostenberechnungen fest, eingetragen in den so genannten Selbstkostenblättern. Aufgrund der dort genannten Bedarfe und Zahlen erfolgen – ohne jegliche Prüfungen – die Auszahlungen, selbst der größte Posten der Personalkosten wird nicht überprüft. Die Behörden behandeln diese Kalkulationen wie Dokumentationen, zum Beispiel werden keine Belege für der Ausgaben gefordert.
Dokumentationspflicht der Leistungserbringer
Mit dieser Pflicht müssten Ärzte, Therapeuten, Kliniken, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ihre Leistungen über die Patienten mit den jeweiligen Kassen abrechnen. Das heißt, jeder Patient/Bewohner erhält von seinem Arzt, Krankenhaus usw. eine detaillierte und nachvollziehbare Leistungsabrechnung. Diese Leistungsabrechnungen werden von den Patienten geprüft, gegengezeichnet und an die jeweilige Kasse zur Begleichung weitergereicht.
Abschaffung der bisherigen Heimaufsicht ...
Eine Heimaufsicht, die kein Interesse daran hat, die Zustände in Heimen zu analysieren und Mängel durch Anordnungen und Auflagen zu beseitigen, hat ihre Legitimation verloren. So wie sie bisher (Ausnahme die bayerische Heimaufsicht) arbeitet, ist sie an Aufdeckung von Missständen offenbar nicht interessiert. Es scheint eher so, dass sie mit den Heimbesitzern kooperiert und bestehende Machtverhältnisse (zum Beispiel die der sozialen Wohlfahrtsverbände) nicht ankratzen möchte. Solange eine Heimaufsicht ihrem Auftrag nicht nachkommt und darin indirekt von den kommunalen Politikern, das heißt durch Schweigen und Stillhalten, unterstützt wird, könnte das jeweilige Bundesland durch ihre Auflösung Verwaltungsgelder sparen.
... oder Umstrukturierung der Heimaufsicht zu einem Kontrollinstrument mit Machtkompetenzen
Eine Heimaufsicht, die tatsächlich eng mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen zusammenarbeitet, könnte die Ergebnisse ihrer Prüfungen direkt den Pflege- und Krankenkassen melden und diese zum Handeln auffordern. Das Personal der Heimaufsicht müsste in Anzahl und Qualifikation so verstärkt werden, dass alle jeweiligen Einrichtungen in ihrem Einzugsgebiet einmal im Jahr besucht respektive kontrolliert werden können.
Abschaffung der Ein-Euro-Jobs
Die Spirale führt ins bodenlose Elend: Erst die Zivildienstleistenden, dann die ABM-Stellen, nun die Ein-Euro-Jobs, sie alle sind keine Ergänzung, sondern der Ersatz für regulär bezahlte Vollzeitstellen qualifizierter Mitarbeiter, wie es auch die Erfahrungsberichte mit den Ein-Euro-Stellen seit Ende 2004 belegen. Ein-Euro-Jobs erleichtern es den Heimbesitzern, ihre unsoziale Einstellungspraxis fortzusetzen und mit immer weniger und weniger motivierten Arbeitskräften ein unverantwortliches Heimangebot weiterzuführen. Zwar gibt es viele Zivis, ABMler, und es wird viele Ein-Euro-Jobber geben, die gute Arbeit machen und sich für die Pflegebedürftigen einsetzen. Doch dürfen diese nicht statt examinierter Pflegekräfte eingesetzt und abgerechnet werden. Sollten sie tatsächlich nur zusätzliche Aufgaben übernehmen, so müsste auch das organisiert werden,– doch welches Heim, welche unterfinanzierte Pflegeeinrichtung wird dies leisten und finanzieren können? Stattdessen wird man sie in den normalen Betriebsablauf integrieren.
Mehr Macht den Pflegerinnen und Pflegern
- Entbindung von der Schweigepflicht für die Dokumentation von Missständen und gefährlicher Pflege
Altenpflegerinnen und Pfleger müssen die Öffentlichkeit informieren können, ohne wegen Verletzung der Schweigepflicht angeklagt zu werden, der sie zurzeit durch ihre Arbeitsverträge unterliegen. Altenpfleger, die ihrem humanen Auftrag nachkommen möchten und die Missstände weder mittragen noch verantworten wollen, dürfen nicht als Nestbeschmutzer, Querulanten und Einzelfälle in der Öffentlichkeit beschimpft und zum Schweigen gezwungen werden. Ihre Aufgabe ist es, die Bewohner zu betreuen und sich für deren Rechte und würdevolles Leben einzusetzen. Ist das Veröffentlichen rechtloser Zustände nicht mehr strafbar, wird es auch einfacher sein, dem beruflichen Auftrag nachzukommen:
- Pflegerinnen und Pfleger: Macht den Mund auf!
Pflegerinnen und Pfleger sollten die Organisationsform des Teams auch für die eigenen Belange nutzen: sich austauschen, gemeinsam für Verbesserungen der Lebens- und Arbeitsbedingungen kämpfen, Forderungen aufstellen und sich nicht abspeisen und einschüchtern lassen. Sie müssen sich verstärkt gegenüber ihren Institutionen für ihre Ideen einsetzen. Sie sollten das Wissen um eure Rechte sammeln, und wenn sich nichts ändert, sich an die Angehörigen, die Presse, die Öffentlichkeit wenden. Denn sie sind verantwortlich für die Menschen, die ihnen anvertraut wurden. Nur noch gefährliche Pflege leisten zu können ist Mord auf Raten. Und die Pflegekräfte, die das mitmachen, sind – leider! – auch Täter.
- Vorrang der Betreuung von Bewohnern vor den Verwaltungsaufgaben
Der permanente Zeitmangel ist zugunsten der Bewohner und ihrer Betreuung zu entscheiden. Das Führen der Dokumentationen und anderer Verwaltungsaufgaben, mit denen nach außen ein reibungsloser Heimablauf vorgegeben wird, sollte im Selbstverständnis der Pfleger erst an zweiter Stelle stehen. Denn lückenlose Dokumentationen signalisieren und belegen, dass alles zu schaffen ist – selbst das Führen dieser Dokumentation. Nicht ausgeführte Leistungen dürfen nicht dokumentiert, also auch nicht abgerechnet werden. Wenn sie dennoch eingetragen werden, ist es Dokumentenbetrug, der angezeigt werden muss.
- Bessere Bezahlung entsprechend den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst
"Für eine menschenwürdige Pflege braucht man menschenwürdige Arbeitsbedingungen." (Claus Fussek)
Das Anfangsgehalt einer Altenpflegerin/eines Altenpflegers liegt bei 1800 Euro brutto für eine Angestellte/einen Angestellten im Alter von 21 Jahren, dies entspricht dem Bundesangestellten-Tarifvertrag (BAT) Gruppe IV a. Mit 25 Jahren sind es 2091,09 Euro monatlich. Manchmal kommen Ortszuschläge und Zulagen dazu, die privaten Betreiber zahlen jedoch meist unter Tarif. (Quelle: BAT 2004, Deutscher Berufsverband für Altenpfleger). Wenn die Gehälter in Anlehnung an die im Öffentlichen Dienst bezahlt werden, kann das Bruttomonatsgehalt zwischen 2275 bis 2433 Euro liegen. (Quelle: Bundesangestellten-Tarifvertrag (BAT). Selbst diese Beträge sind angesichts der Hochleistungsarbeit, des Schichtdienstes und des komplexen Aufgabenfeldes zu niedrig, um längerfristig Menschen für den Beruf zu begeistern und die vielen Aussteiger zu verhindern. Wir fordern –
Gesetzlich verankerte Maßnahmen zur Unterstützung der Leitlinie: Vorrang von Reha und Prophylaxe vor Maßnahmen der Pflege
Die Krankenkassen müssen verpflichtet werden, nach dem Gebot der Wirtschaftlichkeit im Dienste und Interesse des Beitragszahlers zu zahlen, zum Beispiel keine Pauschale für die Anzahl der Betten eines Krankenhauses, sondern Bezahlung nach Belegung, also Bedarf der Betten.
Den Verursacher von Folgekosten haftbar machen:
Dekubitus, Stürze, ... sobald die Krankenkassen signalisieren, dass die Folgekosten in Zukunft der Verursacher zu tragen hat, wird sich die Rate dieser Krankheitsfälle schlagartig reduzieren, wie zum Beispiel in Schweden: Dort verliert der Hausarzt nach dem dritten Dekubitus-Fall seine Zulassung!
© 2005 by WIR-AG • e-mail